
FlowerBeet
Kontakt

Dr. Benedict Wieters
Weitere Informationen
Laufzeit:
07/2021 – 06/2025
Projektteam:
Dr. Benedict Wieters,
Dr. Nicol Stockfisch,
Dr. Heinz-Josef Koch
Abteilung:
Förderung:
Rentenbank
Kooperation(en):
Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB), Landwirtschaftliches Informationszentrum Zuckerrübe (LIZ), Rheinischer Rübenbauer-Verband (RRV), Pflanzenschutz-Dienst der Landwirtschaftskammer NRW (LWK NRW)
Projektidee: Nützlingsförderung durch Blühstreifen
Viröse Vergilbung kann im Zuckerrübenanbau zu starken Ertragsverlusten führen. Die Viren werden dabei durch Blattläuse (vor allem die Grüne Pfirsichblattlaus) übertragen, weswegen zur Ertragssicherung Insektizide angewendet werden.
Im Projekt FlowerBeet liegt der Fokus auf einer alternativen Bekämpfung mittels gezielter Förderung von Nützlingen zur Blattlauskontrolle und auf einer allgemeinen Förderung der biologischen Vielfalt durch überjährige Blühstreifen in Zuckerrübenfeldern. Die Blühstreifen werden im Herbst vor dem Zuckerrübenanbau angelegt. So haben die Blühpflanzen bei Vegetationsbeginn im Folgejahr einen Entwicklungsvorsprung und kommen dadurch schneller zur Blüte als nach einer Aussaat im Frühjahr. Neben der Bereitstellung von Nahrung, bieten die Blühstreifen Insekten frühzeitig einen ungestörten und diversen Lebensraum.
Versuchsaufbau und Parameter
Im Projekt werden zwei Versuchsansätze verfolgt: drei in den Zuckerrübenschlag integrierte Blühstreifen mit insgesamt fünf verschiedenen Blühmischungen oder Randstreifen mit einer Basismischung. Die Versuche finden auf Praxisflächen von Landwirten statt. Die Flächen liegen hauptsächlich im Rheinland, da dort der Druck durch Blattläuse und Vergilbung höher ist, zwei Standorte sind bei Göttingen.
Die Idee hinter der Anlage von Blühstreifen mitten im Feld ist die begrenzte Distanz, welche Nützlinge aus Blühstreifen in die Kultur zurücklegen können. Die Blühpflanzen und Sorten wurden so gewählt, dass sie einerseits attraktiv für Nützlinge sind und andererseits möglichst keine Probleme für die Zuckerrüben verursachen (Verunkrautung, Folgewirkungen in der Nachfrucht). Die Blühstreifen wurden mit einer Breite von 6 m über mindestens 200 m Länge angelegt. Auf dem gesamten Feld mit Ausnahme der Blühstreifen wurde betriebsüblicher Pflanzenschutz durchgeführt mit einer Ausnahme: eine Spritzenbreite neben den Blühstreifen wurden keine Insektizide nach der Aussaat angewendet. Auf dem restlichen Feld wurden Insektizide nach Bekämpfungsrichtwerten eingesetzt.
Im Projekt untersucht werden
die Entwicklung der Blühstreifen,
das Auftreten von Nützlingen und Schädlingen in den Blühstreifen und den angrenzenden Zuckerrüben,
die Wirkung von Blühstreifen, Nützlingen und Schädlingen auf die Entwicklung und Ertrag und Qualität der Zuckerrübenpflanzen.
Zwischenergebnisse
Blühstreifenentwicklung, Auftreten von Blattläusen und Nützlingen im Jahr 2022 und 2023
Die meisten ausgesäten Blühpflanzenarten sind gut aufgelaufen und haben den Winter überstanden, im Verlauf des Jahres trat wenig Unkraut auf. Dies lag unter anderem an einer sehr schnellen Entwicklung der Kornblume, welche andere Arten unterdrückt hat. Die ersten Blüten öffneten sich im April, die meisten ab Mitte Mai.
Eine frühe Prädation durch Nützlinge kann der Etablierung von Blattläusen in Zuckerrüben erheblich entgegenwirken und zu einer geringeren Virusausbreitung beitragen. Im Jahr 2022 traten die Blattläuse bereits kurz nach Aussaat zahlreich auf, die Nützlinge dagegen erst später. Daher konnten sich die Blattläuse schnell vermehren und große Populationen bilden. Die größte Anzahl von Blattläusen wurde zwischen Mitte und Ende Mai beobachtet. Der starke Befall der Zuckerrübenpflanzen war anhand eingerollter und gekräuselter Blätter sehr gut zu erkennen.
Bonitiert wurde in zwei Entfernungen zu den Blühstreifen (3 und 10 m), in einem Bereich ohne Blühstreifen und Insektizid (18 m) und im betriebsüblich behandelten Bereich (38 m). Die Blühstreifen führten teilweise zu einer deutlichen Reduktion der Blattlauszahlen, die Wirkung der Blühmischungen nahm dabei mit der Distanz ab. Zwischen den Mischungen gab es Unterschiede in der Wirksamkeit, neben Ackerbohnen war die Anzahl der Blattläuse in den angrenzenden Zuckerrüben häufig stark reduziert. Eine klare Empfehlung für einzelne Mischungen lässt sich aber noch nicht ableiten. Insektizidanwendungen haben die Blattlauszahlen stark dezimiert, es kam aber wieder zu neuem Zuflug nach den Behandlungen. Im Jahr 2023 war der Druck durch Blattläuse nach einer witterungsbedingt späten Aussaat der Zuckerrüben deutlich geringer und in der Regel unter der Bekämpfungsschwelle. Ein eindeutig positiver Effekt der Blühstreifen ließ sich bei geringer Blattlauszahl nicht feststellen.
Die Daten zu den Nützlingen werden noch ausgewertet. Erste Auswertungen umfassen Spinnen, Kurzflügler und Laufkäfer als Blattlausprädatoren. Im Saisonverlauf wurden Blattlaus-vertilgende Artengruppen wie Marienkäfer und deren Larven, Laufkäfer, Larven von Schwebfliegen und Florfliegen, Webspinnen und Weberknechte, sowie Schlupfwespen gesichtet. In und an den Blühstreifen wurden dabei vermehrt Nützlinge beobachtet als in größerer Entfernung zu den Blühpflanzen.
Auswirkungen auf Vergilbung und Ertrag
Auf den untersuchten Flächen trat in den mit Insektizid behandelten Bereichen keine Vergilbung auf. In den unbehandelten Teilen gab es Vergilbungsnester und je nach Standort waren 2-30 % der Fläche vergilbt. In den Bereichen an den Blühstreifen war die vergilbte Fläche deutlich reduziert und im Schnitt 50 % geringer als ohne Blühstreifen. Interessanterweise gab es an einigen Standorten trotz hoher Blattlauszahlen keine vermehrten Vergilbungssymptome. Eventuell waren die Blattläuse hier nicht mit Viren beladen oder sie wurden von Nützlingen gefressen, bevor sie das Virus weiter übertragen konnten. Im Jahr 2023 wurden kaum Vergilbungsnester beobachtet, es wurden aber Vergilbungsviren in einzelnen Pflanzen nachgewiesen.
Das unterschiedliche Auftreten von Blattläusen und Vergilbungssymptomen in den Feldbereichen ließen Ertragsunterschiede erwarten. Im Mittel über alle Standorte gab es 2022 in Flächen ohne Insektizidanwendung (mit und ohne Blühstreifen) einen signifikant reduzierten Zuckerertrag im Vergleich zu den betriebsüblich behandelten Flächen (2-5 % Verlust). Blühstreifen hatten keinen positiven Effekt auf den Ertrag und zusätzlich reduzieren sie die Zuckerrüben-Anbaufläche. In der ersten Reihe neben den Blühstreifen blieben die Zuckerrübenpflanzen außerdem so klein, dass sie nicht geerntet werden konnten. An drei von acht Standorten kam es zu erheblichen Ertragsverlusten ohne Insektizid von bis zu 16 %. Auf den zwei Standorten bei Göttingen war der Zuckerertrag ohne Insektizideinsatz 3,4 % geringer, die Blühstreifen hatten aber einen leicht positiven Effekt im Vergleich zur Kontrolle. 2023 gab es keine Ertragsunterschiede zwischen den Bedingungen.
Je nach Standort zeigten sich im ersten Jahr unterschiedliche Effekte der Blühstreifen. Blattlausauftreten und Ertragsverluste zeigten keinen eindeutigen Zusammenhang: einige Standorte zeigten trotz hoher Blattlauszahlen kaum Verlust, andere Felder wiesen starke Ertragseinbußen auf. Die Rolle der schwarzen Bohnenlaus war durch das massenweise und sehr frühe Auftreten größer als vorher erwartet. Hier ist noch Forschungsbedarf, um Blattlausauftreten und Ertragsverluste sicherer vorherzusagen und standortangepasste Strategien entwickeln zu können.
Bewertung & Ausblick
Was könnte das für die Praxis bedeuten?
Trotz der hohen Nützlingsaktivität und der Reduktion der Blattlauszahlen in der Nähe von Blühstreifen zeigte sich nicht der erwartete positive Effekt in den Bereichen mit Blühstreifen. Für die Gesamtbewertung des neuen Anbausystems muss auch der Verlust von Anbaufläche durch die Blühstreifen und mögliche Nachwirkungen von Blühstreifen für die folgenden Kulturen unbedingt berücksichtigt werden. Bisher wurden keine gravierenden Probleme festgestellt, Blühpflanzen finden sich aber häufig auch in der Folgekultur.
Selbst wenn sich das System in der derzeitigen Form nicht auszahlen sollte, sind die Erkenntnisse wertvoll. Das Anbauverfahren kann im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes mit anderen Maßnahmen kombiniert und weiter optimiert werden, um Kosten und Aufwand zu senken. Als flexible Schutzmaßnahme gegen Blattläuse und auch andere Schädlinge ist die Förderung von Nützlingen eine grundsätzlich sinnvolle Maßnahme, da sie Populationen von Schädlingen unabhängig von der Verfügbarkeit wirksamer Insektizide regulieren können. Eine allgemeine Förderung der Artenvielfalt von Pflanzen, Insekten und anderen Tieren auf Ackerflächen kann so zu einer Robustheit des Anbausystems gegenüber Störungen beitragen.
Projektpartner
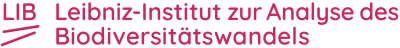



Förderung
Die Förderung des Vorhabens erfolgt aus Mitteln der Landwirtschaftlichen Rentenbank.

Kontakt









